Am 10. Mai jährt sich die von der „Deutschen Studentenschaft“ organisierte Bücherverbrennung von 1933. Nicht nur in Berlin auf dem Opernplatz – heute Bebelplatz – wurden Bücher verbrannt, auch in anderen deutschen (v.a. Universitäts-)Städten fand dieser Terror gegen die Meinungsfreiheit statt. Die Aktion stand unter dem Motto „Wider den undeutschen Geist“; und weiter: „Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Es klafft heute ein Widerspruch zwischen Schrifttum und deutschem Volkstum. (…) Unser gefährlichster Widersacher ist der Jude, und der, der ihm hörig ist.“
Opfer der Flammen
Zu den Autoren, deren Werke auf dem Opernplatz verbrannt wurden, gehörten sozialistische Klassiker wie Karl Marx und Karl Kautsky, politische Publizisten wie Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky, Wissenschaftler wie Sigmund Freud und Magnus Hirschfeld, Schriftsteller wie Heinrich Mann und Erich Kästner. Letzterer war als Beobachter anwesend und hörte die Rede von Goebbels, diesem „kleinen, abgefeimten Lügner“, so Kästner. Eines der verbrannten Bücher Kästners war der 1931 erschienene Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“; die Nationalsozialisten bezeichneten dieses Buch als „entartet“ und „pornografisch“. Die Hauptfigur Fabian hält sich im Laufe der Romanhandlung einige Male im Wedding auf, wo er seine Geliebte besucht.
Büchervernichtungsaktionen der Nazis gab es bereits in den Monaten zuvor, nicht so zentral koordiniert und propagandistisch, sondern als Teil der Terrorwelle gegen linke Parteien, Gewerkschaften, Organisationen und deren Mitglieder. Es wurden Bücher, Akten, Fahnen auf die Straße geworfen und zerstört, häufig mit Benzin übergossen und angezündet. Die erste größere Bücherverbrennung in Berlin fand am 15. März auf dem Laubenheimer Platz (heute Ludwig-Barnay-Platz) in der Künstlerkolonie Wilmersdorf statt: Nach einer Durchsuchungsaktion von SA und Polizei wurden die entwendeten Bücher auf dem Platz verbrannt. In der Künstlerkolonie lebte auch Ilse Trautschold, die der linken „Gruppe junger Schauspieler“ angehörte und mit dem 1929 gedrehten Wedding-Spielfilm „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“ in einer der beiden weiblichen Hauptrollen einem großen Publikum bekannt wurde.
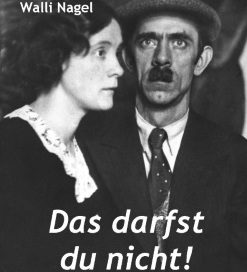
Auch Walli Nagel berichtet in ihren Erinnerungen („Das darfst du nicht! Von Sankt Petersburg nach Berlin-Wedding“), wie sie und ihr Mann, der Maler Otto Nagel (beide waren in der KPD), den Beginn der NS-Diktatur erlebten. Ihre Wohnung in der Turiner Straße 10, nicht weit vom Leopoldplatz, wurde im März 1933, kurz nach dem Reichstagsbrand, von SA-Leuten gestürmt: „Sie kamen in unsere Wohnung, nahmen Bilder von den Wänden, all das flog aus dem offenen Fenster auf den Hof. Damit es schneller ging, zerschlugen sie das große Berliner Fenster, und noch mehr flog hinaus. Als sie gingen, nahmen sie den ‘Jungkommunisten’ [ein Gemälde Otto Nagels] und zwei weitere Bilder sowie einige Bücher mit.“ Walli Nagel, eine energische und mutige Frau, fand heraus, dass die SA-Leute einen Teil der Bilder und Bücher in ihr Lokal gebracht hatten. Sie ging einige Tage später hin und verlangte die Sachen zurück. Die dort befindlichen Bilder erhielt sie. „Und die Bücher, bekomme ich die auch zurück? – Nein, die sind beschlagnahmt, und sie werden vernichtet.“
In den Folgejahren kam es immer wieder zu regionalen Aktionen, bei denen Bücher beschlagnahmt und verbrannt wurden. Und die „Aussonderung“ von missliebiger Literatur wurde systematisiert und bürokratisch organisiert; eine von der „Reichsschrifttumskammer“ herausgegebene „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ erschien 1935 und erweitert 1938: Auf ca. 180 Seiten wurden grob geschätzt weit über 4.000 deutsche und internationale Autor*innen mit ihren Werken aufgeführt, die laut Vorwort „das nationalsozialistische Kulturwollen gefährden“, weshalb deren Verbreitung „durch öffentliche Bibliotheken und durch den Buchhandel in jeder Form“ verboten wurde.
Auf dieser Liste standen auch „Sämtliche Schriften“ des linken, zeitweise dem Anarchosyndikalismus nahestehenden Schriftstellers Theodor Plievier, dessen Geburtshaus sich in der Wiesenstraße 29 befand (an dem heutigen Neubau ist eine Gedenktafel angebracht), sowie der Roman „Brennende Ruhr“ (1928) von Karl Grünberg, Mitbegründer des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller“. Grünberg schrieb den Roman, als er für einige Jahre in Gesundbrunnen lebte; 1933 war er ein halbes Jahr im KZ Sonnenburg inhaftiert. Und der ‚Klassiker‘ „Barrikaden am Wedding“ von Klaus Neukrantz durfte selbstverständlich nicht fehlen. Neukrantz wurde 1933 verhaftet, misshandelt, kam in eine Nervenheilanstalt; sein weiteres Schicksal ist unbekannt.
Auch ein Werk von Paul Gurk, der im Afrikanischen Viertel lebte, der Roman „Tresoreinbruch“ über das Leben der „Geldschrankknacker“-Brüder Sass, wurde auf die Liste gesetzt. Franz und Erich Sass, in ärmlichen Verhältnissen in der Moabiter Birkenstraße aufgewachsen, wurden 1940 von den Nazis ermordet. Andere Bücher Gurks konnten während des „Dritten Reichs“ erscheinen, allerdings nicht sein 1936 fertiggestellter Roman „Laubenkolonie Schwanensee“, in welchem er den Untergang einer Weddinger Kleingartenkolonie erzählt.
Im Wedding lag der Reichstags-Wahlkreis von Wilhelm Liebknecht, dem Mitbegründer der SPD, dessen „Sämtliche Schriften“ ebenfalls dem Verdikt der Nazi-Liste zum Opfer fielen (genauso wie „Sämtliche Schriften“ seines Sohns Karl Liebknecht). Auch drei dem Wedding verbundene KPD-Politiker finden sich auf der Verbotsliste: So die hier geborene Sozialpolitikerin und Reichstagsabgeordnete Martha Arendsee mit ihrer Schrift „Kinder hungern! Kinder sterben! Wir klagen an“ (1932). Des Weiteren die kurzzeitige, später aus der Partei ausgeschlossene KPD-Vorsitzende Ruth Fischer mit „Sämtlichen Schriften“; Ruth Fischer lebte in Britz, im Wedding war sie für das Bezirksamt als Sozialfürsorgerin tätig. Ihr Bruder, der Komponist Hanns Eisler, verfasste die Musik für das Arbeiterlied „Roter Wedding“. Und schließlich der Arzt und Bezirkspolitiker Georg Benjamin mit seiner gesundheitspolitischen Schrift „Tod den Schwachen? Neue Tendenzen der Klassenmedizin“, in welcher er „gegen den Abbau der sozialen Fürsorgeeinrichtungen in Deutschland“ argumentiert und sich „mit neu auftauchenden rassenhygienischen Ideen, die zu allererst proletarische Bevölkerungsschichten betrafen“, auseinandersetzt, so Bernd-Peter Lange in seiner Benjamin-Biografie „Ein bürgerlicher Revolutionär im roten Wedding“. Georg Benjamin wurde 1942 im KZ Mauthausen ermordet.

Nur auf den ersten Blick überraschend stehen auf der Verbotsliste auch zwei Bücher von Heinrich Zille: das eine – „Für Alle!“ – erschien 1929 im KPD-nahen Neuen Deutschen Verlag, herausgegeben von Otto Nagel, der mit Zille befreundet war. In seinem Vorwort erläutert Nagel, weshalb hier der „unverfälschte, unfrisierte“, der sozialkritische und antimilitaristische Zille zu sehen ist. Das Buch richtete sich gegen den seinerzeitigen kommerzialisierten Zille-Rummel und die Verkitschung von Zilles Werk. Das war auch die Absicht des Films „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“, dessen Handlung auf eine von Otto Nagel weiterentwickelte Idee Zilles zurückgeht. Der Film wurde im April 1933 von den Nazis verboten; die auffindbaren Kopien wurden zerstört.
Der Autor Walter Frey ist Herausgeber der Buchreihe „Wedding-Bücher“.
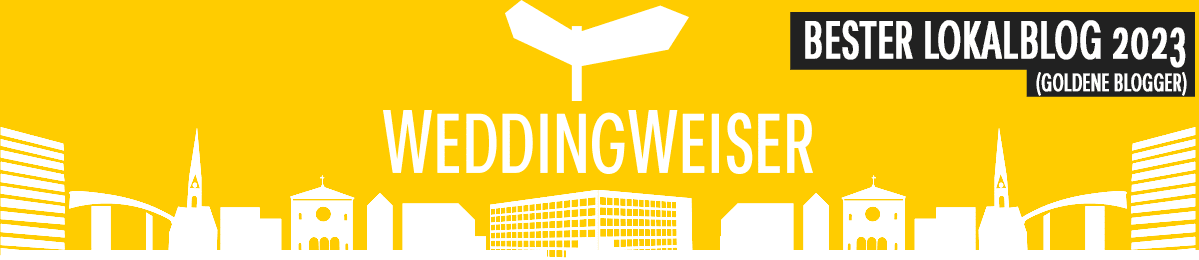

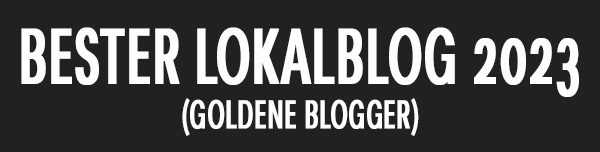
Ich schließe mich Werner und Christoph an und hoffe, dass wir bald wieder Lesungen oder Aktivitäten mit “Wedding-Bücher” im SprengelHaus machen können!
Sehr ausführlicher und informativer Beitrag.
Hochinteressanter Artikel !
Wusste ich Alles nicht.
DANKE !