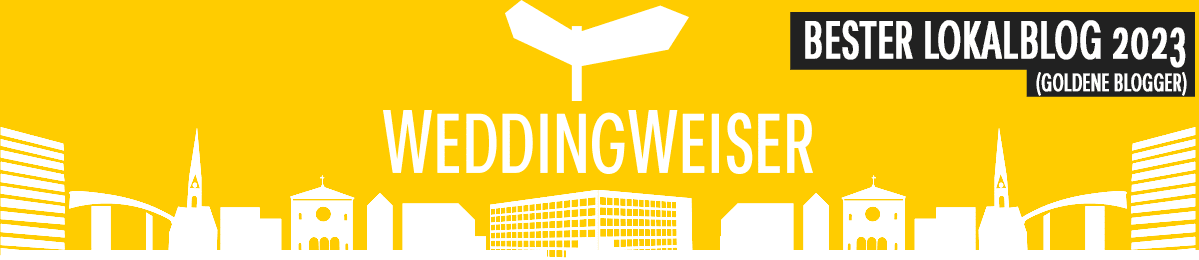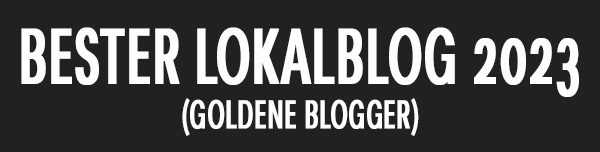Abschied von der alten “Tante Tegel”
Update Himmlische Ruhe am Himmel! Neue Lebensqualität in der Einflugschneise. Doch so einfach ist es mit der Tegel-Schließung dann doch nicht. Denn fragt man die Weddinger nach ihrer Meinung zum Thema, bekommt…