Auf den ersten Blick wirkt die weitgehend flache Topographie unseres Stadtteils nicht besonders interessant. Dabei gibt es hier durchaus natürliche Gegebenheiten, die den Wedding bis heute prägen, und sei es nur in den Namen, die sich heute hier noch finden.

So wie hier auf der Düne Wedding haben viele Teile des Stadtteils ursprünglich ausgesehen.
Ein paar Fakten vorweg. Der Wedding liegt etwa 35 – 45 Meter über dem Meeresspiegel. Seine landschaftliche Erscheinung ist von der letzten Eiszeit geprägt. Im Westen des Wedding wurden aus Flugsand mehrere Dünenketten gebildet, dazwischen befinden sich Seen und Fenne, die als Reste früherer Gewässer verblieben sind. Südlich von Reinickendorf nannte man die Dünen “Wurzelberge” (etwa auf dem Gelände des heutigen Schillerparks). Im Westen heißen die Sanddünen Leutnantsberge und Rehberge. Auf den Dünen gab es allenfalls Gräser und einige Kiefern, teilweise eine dünne Humusschicht, ansonsten lag der Sand frei. Die heutige Seenkette Möwensee, Sperlingssee und Entenpfuhl hieß früher „Das Lange Fenn“. Es existierten auch zwei natürliche Seen im heutigen Wedding, am bekanntesten ist natürlich der Plötzensee (früher Großer Plötzensee). Es gab auch einen Kleinen Plötzensee. Dieser ging 1850 im Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal auf. Der Schwarze Graben hingegen ist kein natürliches Gewässer, sondern ein Entwässerungskanal des 18. Jahrhunderts.



l: Rehberge, m: Formung der Sanddünen zu den Rehbergen, r.: Militärbadeanstalt Plötzensee 1920
Unser (Ab)Fluss ist die Panke
Der Wedding hat zwei Geländetypen, die Talsandflächen und den südwestlichen Zipfel der Hochfläche des Barnim, eine Grundmoräne aus Geschiebelehm. Das Berliner Urstromtal mit der Spree liegt zwischen dem Barnim und der Teltow-Hochfläche.
Auf der Barnim-Hochfläche befindet sich die Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee. Das einzige natürliche Gewässer, das den Wedding und Gesundbrunnen durchzieht, ist die Panke. Das Pankewasser fließt zum kleinen Teil wieder an der Friedrichstraße in die Spree und hauptsächlich über den Schiffahrtskanal in die Havel – somit in die Elbe und in die Nordsee. Die Panke wurde ab 1708 so oft umgeleitet und in einen Abwasserkanal verwandelt, dass man ihre natürliche Herkunft kaum noch erahnen kann. So wurde beispielsweise an der Travemünder und der Gropiusstraße ein Mühlengraben angelegt, wodurch eine Insel entstand. Der alte Arm wurde später zugeschüttet (Uferstraße). Die an der Panke liegenden Wassermühlen wurden durch die für diesen Fluss typischen Hochwässer mehrfach zerstört. Sogar der Abfluss wurde verändert, sodass die Panke spätestens ab 1961 in Richtung Nordhafen/Schifffahrtskanal abfloss. Das alte Flussbett in Richtung Spree wurde verrohrt und von der Panke abgeschnitten. Als Südpanke wurde es nach 1990 wieder freigelegt und mit dem heutigen Pankeabfluss an der Schulzendorfer Straße verbunden.
Der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal selbst wurde ab 1848 gegraben, ist also ein vollständig künstliches Gewässer.


Unter dem Pflaster der Sand
Wie muss man sich die Landschaft zwischen Plötzensee und Panke vorstellen? Neben den besagten Flugsanddünen wucherten Kieferngehölze, die sich mit Feuchtgebieten abwechselten. Landwirtschaft war kaum möglich, da die Bodenbeschaffenheit als sehr ungünstig galt. Die Eiszeit hinterließ im heutigen Wedding den sogenannten Pankesander. Sander bestehen bei uns aus Quarzsand und sind daher unfruchtbar. Sie sind da entstanden, wo Gletscherschmelzbäche während der Weichseleiszeit vor mehr als 20.000 Jahren die Endmoräne durchschnitten und sich als stark verflochtener Fluss verbreiterten. Dadurch verlor der Schmelzbach an Geschwindigkeit und lagerte das mitgeführte Material als Sediment ab.
Gab es Landwirtschaft? 1289 wurde auf dem Wedding erstmals ein Gehöft erwähnt, aber von einem gleichnamigen Dorf gibt es keine Spuren. Die unfruchtbare sandige Heidelandschaft, in der es nur wenige Äcker gab, war auch für die Stadt Berlin höchstens als Weideland von Interesse. Im Vorwerk Wedding, einem Gutshof, der in etwa an der heutigen Weddingstraße lag, wurden vor allem Viehwirtschaft und eine Schäferei betrieben. Später jagten die preußischen Könige Kaninchen in einem Jagdterrain an der heutigen Bellermannstraße. Ansonsten eignete sich der sandige Boden gut als Artillerieschießplatz, der sich ungefähr westlich des Louise-Schroeder-Platzes befand (danach wurde die Exerzierstraße benannt).
Doch so richtig mit diesem “nutzlosen” Gebiet abfinden wollten sich die preußischen Regenten nicht. Ab 1770 wurden auf königliches Betreiben Kolonisten aus Süddeutschland an der heutigen Gottsched- und Reinickendorfer Straße angesiedelt, die das Land kultivieren sollten (Kolonie Neu-Wedding). 1781 wurden weitere 25 Kolonisten angesiedelt, sie bekamen ihr Haus geschenkt (Kolonie hinter dem Gesundbrunnen). Es waren allerdings keine Ackerbauern, sondern Obst- und Gemüsebauern. Das letzte Kolonistenhaus aus dem Jahr 1782 an der Koloniestraße 57 gibt es heute noch. In der Kolonie befand sich auch eine Maulbeerplantage. Zur Bewässerung diente die Panke.



Heilwasser und Windkraft
Apropos Wasser. 1748 kam man auf die Idee, das Wasser an der Pankemühle untersuchen zu lassen. Es erwies sich als stark eisenhaltig und war anderen Heilwässern nicht ganz unähnlich. Das Wasser der Quelle gefror nicht, so eisenhaltig war es. Daraus entstand der Badebetrieb am Gesundbrunnen – dessen Name und der der Badstraße sowie der Brunnenstraße gehen darauf zurück. Doch bei dem einsetzenden Bauboom Ende des 19. Jahrhunderts versiegte die Heilquelle endgültig.
Nicht nur Wasserkraft wurde im Wedding genutzt. Der starke Wind, der keine natürlichen Hindernisse vorfand, ließ zwar den Flugsand in die Häuser und Wohnungen fliegen, aber er eignete sich auch für Windmühlen, die ab 1809 entstanden. Entlang der Müllerstraße soll es 1846 bis zu 22 Windmühlen gegeben haben, die gemeinsam mit umliegenden Mühlen den größten Mühlenstandort Berlin bildeten. Auch der Straßenname bezieht sich natürlich auf den Berufsstand des Müllers.



Die Sanddünen werden geformt und bepflanzt
Wie schon erwähnt, war Flugsand für die wenigen Bewohner der Müllerstraße äußerst störend. Zwar eignete er sich als feiner Scheuersand, aber 1903 kaufte die Stadt das Gelände auf, um dort einen Park (Schillerpark) anzulegen. Dazu wurde der Sand mit einer 35 cm dicken Schicht aus Hausmüll und 35 cm dicken Schicht aus Dungboden bedeckt.
Die Vegetation von Kiefern und Traubeneichen der Rehberge war durch den Schießplatz der Artillerie und die wilde Abholzung für Feuerholz nach dem 1. Weltkrieg abgetragen worden. Die Dünen dort waren so kahl, dass sogar Wüstenfilme gedreht werden konnten. Ab 1926 wurde der Volkspark von Berlin aus Notstandsmitteln erworben und als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angelegt. Auch hierfür wurde Mutterboden und Straßendung in großen Mengen herangeschafft.
Geographie bis heute erlebbar
Wo ist die Landschaft des Wedding heute noch erfahrbar? Am ehesten vielleicht auf der hohen Sicheldüne des Volksparks Rehberge, wo ein Höhenwanderweg (Carl-Leid-Weg) vom Stadion Rehberge zum Rathenaubrunnen angelegt wurde. Außerdem handelt es sich beim 7 Hektar großen Plötzensee und bei der Panke um natürliche Gewässer. Wie die Vegetation im Wedding ursprünglich aussah, ist nur noch auf der Düne Wedding erfahrbar. Dort kümmert sich der NABU durch regelmäßige Pflege darum, dass seltene Gräser erhalten bleiben und nur ortstypische Bäume und Gehölze dort wachsen. Es handelt sich dabei um ein kleines Refugium für bestimmte Seggen, Moose und auch Zauneidechsen. Die Düne liegt auf dem Gelände des Schul-Umwelt-Zentrums an der Scharnweberstraße und ist nur im Rahmen einer Führung betretbar.



Entlang der Ackerstraße im Brunnenviertel kann man die Hangkante des Barnim-Plateaus noch heute sehen (die Scheringstraße, die Feldstraße und die Grenzstraße haben kurze Steigungen). Die mit 85 Metern höchste Erhebung des Wedding, die Humboldthöhe am Flakturm im Humboldthain, ist allerdings nicht natürlichen Ursprungs, sondern durch die teilweise Zuschüttung des Flakturms entstanden.
Was bleibt noch? Zahlreiche Straßennamen deuten auf die Geografie des Wedding hin: Seestraße, Torfstraße, Fennstraße, Triftstraße, Ackerstraße, Feldstraße, Gartenstraße, Pankstraße – der Wedding war eben nicht immer ein Moloch voller Menschen und Häuser, sondern die meiste Zeit eine ländliche Gegend vor den Toren der großen Stadt.



Wo der höchste und der tiefste Punkt des Wedding liegen, erfahrt ihr hier.
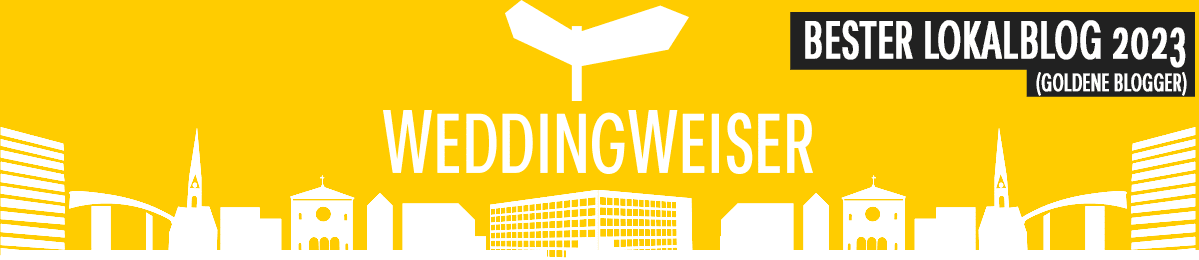

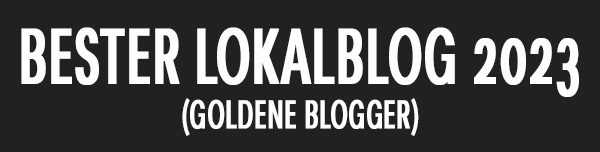


Ich bin am Gesundbrunnen 60er Jahre aufgewachsen. Meine Familie, kam 1895 aus den ostdeutschen Gebieten dorthin und blieb ihm treu. Die Zeichnung von Hövener wurde auch als Gemälde verewigt und hing über 40 Jahre, bei meiner Oma. Leider hat man es nach ihrem Tod, weggeworfen (eine Schande) der Maler hieß Schillowski oder so ähnlich. Habe bisher leider nichts über ihn gefunden. Die Panke war immer ein Mittelpunkt meiner Kindheit, so wie die Geschichte des Wedding, bis heute
Seit 44 Jahren im Wedding (anfangs zufällig, jetzt nicht mehr wegzudenken!) habe ich den Artikel mit großem Interesse und Wissensgewinn genossen. Immer schön, wenn ein kompetenter Mensch seine Kenntnisse auch sprachlich kompetent vermittelt.
Ich fühle mich auch heute nicht “in einem Moloch” 😉
Danke für den sehr interessanten Artikel!
Super interessant. Ich wohne seit 28 Jahren in Gesundbrunnen und vieles von dem genannten wusste ich schon. Allerdings sind es die Zusammenhänge und die Details die diesen Artikel so lesenswert machen. Vielen Dank!