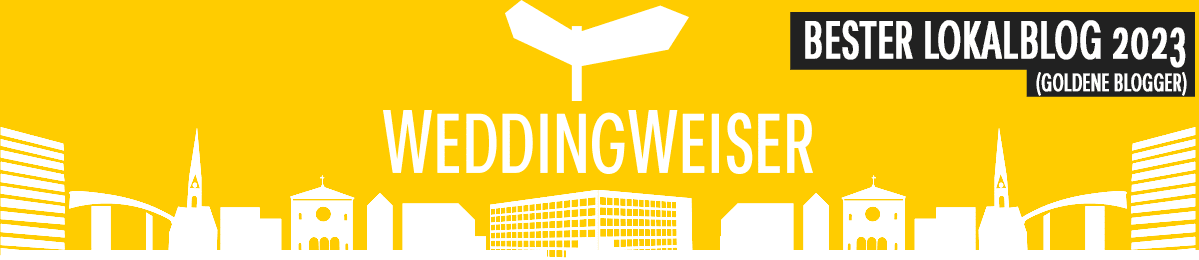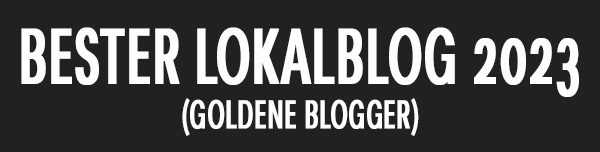Unsere Serie: Im Afrikanischen, im Englischen oder im Brüsseler Viertel, aber auch im Brunnenviertel oder im Soldiner Kiez sind viele Straßen nach Ländern, Orten oder mit Bezug auf Kriegsschauplätze benannt. Da kann man schon eine kleine Weltreise machen. So mancher Straßenname im Wedding und Gesundbrunnen klingt merkwürdig. Nicht wenige sind nach Personen benannt. Wer dahinter steckt, dürfte allerdings kaum jemand wissen. Wir erklären euch kurz, mit wem wir es da zu tun haben.
Unsere Serie: Im Afrikanischen, im Englischen oder im Brüsseler Viertel, aber auch im Brunnenviertel oder im Soldiner Kiez sind viele Straßen nach Ländern, Orten oder mit Bezug auf Kriegsschauplätze benannt. Da kann man schon eine kleine Weltreise machen. So mancher Straßenname im Wedding und Gesundbrunnen klingt merkwürdig. Nicht wenige sind nach Personen benannt. Wer dahinter steckt, dürfte allerdings kaum jemand wissen. Wir erklären euch kurz, mit wem wir es da zu tun haben.
Als vor dem 1. Weltkrieg Straßen zu benennen waren, entschied man sich erneut für Persönlichkeiten, die in Berlin besondere Erfindungen getätigt oder sich um Kunst und Wissenschaft verdient gemacht hatten. Zwischen Nauener Platz und Badstraße wurden vier Straßen nach Schriftstellern benannt, ohne jeden Bezug zum Wedding.
Schriftstellerviertel
 Martin-Opitz-Straße seit 1906
Martin-Opitz-Straße seit 1906
Der Schriftsteller, Jurist und Philologe Martin Opitz von Boberfeld, * 1597 in Schlesien, + 1639 Danzig absolvierte ein Jurastudium in Frankfurt (Oder). Dort gab er bereits eine Sammlung lateinischer Gedichte heraus. Nach Stationen in Süddeutschland und in Österreich-Ungarn nahm Opitz 1634 kurz in Berlin Aufenthalt. 1637⁄38 wurde er vom polnischen König zum Königlichen Historiographen ernannt. Von den Zeitgenossen als Dichter bewundert, lag seine Bedeutung für die deutsche Literatur mehr auf dem Feld der Literaturtheorie und der Erhaltung einer deutschsprachigen Poesie in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, dessen Ende – er starb 1639 an der Pest – er nicht mehr erleben konnte. 1690 erschienen in Breslau postum drei Bände seiner Werke.
Gottschedstraße seit 1906
Der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched, , * 1700 Judittenkirchen b. Königsberg, + 1766 Leipzig, begann 1714 ein Studium in Königsberg. Seit 1734 war Gottsched ordentlicher Professor in Leipzig. In den Jahren von 1734 bis 1766 hatte er fünfmal das Amt des Rektors der Universität Leipzig inne. Besondere Verdienste erwarb er sich um die Festlegung der deutschen Schriftsprache. 1730 war sein Buch “Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen” erschienen.
Schererstraße seit 1906,
Der Germanist und Schriftsteller Wilhelm Scherer, * 1841 Österreich, + 1886 Berlin, studierte 1858 Philologie an der Universität Wien. 1864 habilitierte er sich in Wien und wurde dort auch ordentlicher Professor. 1872 ging er an die Universität nach Straßburg, und 1877 wurde er auf den neuenLehrstuhl für neuere deutsche Literatur an die Berliner Universität berufen. Er wurde Mitglied der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaft und Vizepräsident der Goethe-Gesellschaft. 1880–1883 kam seine „Geschichte der deutschen Literatur“ heraus, die in der Fachwelt ihrer Solidität der Untersuchungen wegen große Aufmerksamkeit erregte. Scherer war 1874 einer der Gründer der periodisch weitergeführten Sammlung „Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker“.
Bornemannstraße seit 1910
Der Schriftsteller Johann Wilhelm Jakob Bornemann, * 1766 Gardelegen, + 1851 Berlin schrieb „Plattdeutsche Gedichte”. Sein Lied „Im Wald und auf der Heide“ ist noch heute bekannt und gehört zum Schatz der deutschen Volkslieder. Bornemann wollte ursprünglich Theologe werden, schlug aber die Verwaltungslaufbahn ein, wo er es bis zum Generaldirektor der Preußischen Staatslotterie brachte.
Vielseitig talentierte Menschen
Gropiusstraße seit 1891
Den Gropiusbau kennt man – denn dieser wurde von diesem 1824 geborenen Architekten Martin Gropius als Kunstgewerbemuseum entworfen. Eigentlich sollte Gropius die väterliche Fabrik übernehmen. Deshalb absolvierte er eine gewerbliche Ausbildung, wechselte aber ins Baufach, wo er 1855 erfolgreich die Baumeisterprüfung ablegte und danach an der Bauakademie. lehrte. Gropius war Mitglied des Senats der Akademie der Künste und leitete alle Kunstschulen in Preußen. 1880 starb er in Berlin.
Orthstraße seit 1902
Der Architekt August Friedrich Wilhelm Orth, * 1828 , + 1901 Berlin, legte 1858 seine Baumeisterprüfung ab. 1872–1877 war er Vorstandsmitglied des Architekten-Vereins und wurde 1878 Mitglied der Akademie der Künste. Orth zählte zu den Mitbegründern der Vereinigung Berliner Architekten und wurde später ihr Vorsitzender. Zu seinen Leistungen zählen zwei Patente zur Verbesserung der Akustik und zum Gewölbebau. Er entwarf und erbaute u. a. die Weddinger Dankeskirche (zerstört), die Weddinger Himmelfahrtskirche (zerstört) und die Zionskirche. An der Brunnenstraße errichtete er den Berliner Viehmarkt. Die Orthstraße ist heute eine der kürzesten Straßen Berlin und verläuft hinter dem Amtsgericht an der Panke.
Schönstedtstraße seit 1902
Der Jurist und Politiker Karl Heinrich von Schönstedt, * 1833, + 1924 Berlin, war beim Appellationsgericht in Hamm, später bei der Staatsanwaltschaft in Essen beschäftigt. Zwischen 1894 und 1905 war er preußischer Staats- und Justizminister. 1895 wurde er Mitglied des Herrenhauses und Kronsyndikus auf Lebenszeit. 1911 erhielt er den erblichen Adelstitel verliehen.
Bastianstraße seit 1906
Der Ethnologe Adolf Bastian, * 1826 Bremen, + 1905 Trinidad war studierter Mediziner und unternahm von 1851 bis 1859 ausgedehnte Forschungsreisen nach Australien, Ozeanien, Nord‑, Süd- und Mittelamerika, Süd- und Südostasien, Vorderasien, Ägypten, Süd- und Westafrika. 1860 gab er „Der Mensch in der Geschichte“ heraus. Seit 1868 war er Direktor des von ihm gegründeten Berliner Museums für Völkerkunde. 1873 übernahm er die Leitung der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland. Bastian gilt als der Begründer der modernen Völkerkunde.
Spanheimstraße seit 1910
Der Diplomat und Politiker Ezechiel Reichsfreiherr von Spanheim,* 1629 Genf, + 1710 London studierte ab 1642 an der Universität Leiden. 1680 wechselte er in kurbrandenburgische Dienste und wirkte als Gesandter am französischen Hof. Ab 1689 war er Leiter der französischen Kolonien im Kurfürstentum Brandenburg. Bis 1697 hielt sich Spanheim in Berlin auf. Er war gemeinsam mit Leibniz Begründer der Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Der Schweizer Mathematiker und Phyasiker Leonhard Euler, * 1707, + 1783 St. Petersburg, stammte aus einer Baseler Gelehrtenfamilie. 1727 traf er in St. Petersburg ein. Hier lehrte und forschte Euler und erhielt 1730 eine Professur für Physik. Nach Berlin gerufen, war er von 1741 bis 1766 als Direktor der mathematischen Klasse der Akademie der Wissenschaften tätig. Euler publizierte sowohl auf mathematischem als auch auf mechanischem, musiktheoretischem und astronomischem Gebiet. 1766 kehrte Euler nach St. Petersburg zurück. Er galt als der bedeutendste Mathematiker des 18. Jahrhunderts, bekannt für die Eulersche Zahl.
Künstler
Graunstraße seit 1894
Der Komponist Carl Heinrich Graun, 1704 – 1759, war bis 1720 Schüler an der Kreuzschule Dresden. 1725 trat er in Braunschweig als Operntenor auf, ab 1735 war Graun bei Friedrich dem Großen engagiert und wirkte ab 1740 als Hofkapellmeister in Berlin. 1742 wurde das Opernhaus Unter den Linden mit seiner Oper „Cesare e Cleopatra“ eröffnet. Graun verfasste 34 Opern, darunter „Montezuma“.
Lortzingstraße seit 1895
Der Komponist Gustav Albert Lortzing, * 1801 , + 1851, brachte 1826 bis 1833 erste Werke zur Aufführung. Er war auch als Sänger und Schauspieler in Düsseldorf, Köln und Leipzig engagiert. Später wirkte Lortzing als Kapellmeister am Leipziger Hoftheater und im Theater an der Wien. 1850 wurde er Kapellmeister am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin. Er schrieb zum Teil die Libretti seiner Opern selbst. Seine Werke wurden auch wegen ihrer volkstümlichen Art sehr bekannt. Er gilt für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts als der bekannteste Vertreter der heiter-volkstümlichen deutschen Spieloper. Zu seinen Werken gehören die Opern „Zar und Zimmermann“ (1837), „Hans Sachs“ (1840), „Der Wildschütz“ (1842), die Märchenoper „Undine“ (1845) und „Der Waffenschmied“ (1846).
Gleimstraße seit 1892
 Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 1719 – 1813, besuchte die Schule in Wernigerode und studierte Jura und Philosphie in Halle. 1740 war er als Hauslehrer in Potsdam tätig. Als Sekretär des Prinzen Wilhelm Heinrich von Brandenburg-Schwedt nahm Gleim am Schlesischen Krieg teil. In Berlin fand Gleim einen Kreis gleichgesinnter Dichter und Philosophen. 1747 wurde Gleim Sekretär des Domkapitels in Halberstadt. 1756 erhielt er das Kanonikat des Stifts Walbeck bei Helmstedt, sodass er finanziell gesichert seinen Traum vom Leben als Dichter und Förderer der Kunst realisieren konnte. 1756 erschien sein erstes Buch mit Fabeln. Der als Papa Gleim verehrte Dichter veröffentlichte in der Folgezeit viele Lieder und Gedichtsammlungen und war als literarischer Vermittler tätig.
Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 1719 – 1813, besuchte die Schule in Wernigerode und studierte Jura und Philosphie in Halle. 1740 war er als Hauslehrer in Potsdam tätig. Als Sekretär des Prinzen Wilhelm Heinrich von Brandenburg-Schwedt nahm Gleim am Schlesischen Krieg teil. In Berlin fand Gleim einen Kreis gleichgesinnter Dichter und Philosophen. 1747 wurde Gleim Sekretär des Domkapitels in Halberstadt. 1756 erhielt er das Kanonikat des Stifts Walbeck bei Helmstedt, sodass er finanziell gesichert seinen Traum vom Leben als Dichter und Förderer der Kunst realisieren konnte. 1756 erschien sein erstes Buch mit Fabeln. Der als Papa Gleim verehrte Dichter veröffentlichte in der Folgezeit viele Lieder und Gedichtsammlungen und war als literarischer Vermittler tätig.
Ramlerstraße seit 1892
Der 1725 geborene Aufklärer Karl Wilhelm Ramler, 1725 – 1798 , kam 1745 erstmals nach Berlin, wo er auch Ludwig Gleim kennenlernte, der ihm eine Hauslehrerstelle in Werneuchen verschaffte. 1747 kam er wieder nach Berlin zurück und lehrte ab 1748 Philosophie an der Kadettenschule, Neue Friedrichstraße. Ab 1786 ordentliches Mitglied der Akademie der Künste und Mechanischen Wissenschaften, später auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften, wurde Ramler 1790 einer der Direktoren der Königlichen Schauspiele.
Im dritten Teil geht es Militärs und besondere Persönlichkeiten.