Wer heute an der unwirtlichen Osloer Straße aus der U-Bahn steigt, denkt wahrscheinlich kaum an norwegische Fjorde. Dabei steckt in diesem Straßennamen eine bemerkenswerte Geschichte, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht und über Berlin hinaus bis nach Skandinavien führt.


Die Straße mit dem königlichen Namen
Die heutige Osloer Straße wurde am 8. März 1892 offiziell benannt – zunächst als Christianiastraße. Das passte gut in die Zeit: Berlin dehnte sich weit über die alten Stadtgrenzen hinaus aus, neue Quartiere entstanden, Straßen wurden geplant und erhielten Namen – oft nach fernen Orten, die man mit dem Zug erreichen konnte. So reihten sich im Nordwesten Berlins bald Straßen wie die Drontheimer, Schweden- oder Malmöer Straße aneinander. Auch Christiania, der damalige Name der norwegischen Hauptstadt, wurde Teil des Berliner Stadtbilds.


Die Straße verband damals als Teil einer Ringstraße die Badstraße mit der Bornholmer Straße – eine neu geschaffene Verkehrsachse, die in den Folgejahren zunehmend an Bedeutung gewann. Bald entstanden hier große Wohnhäuser, Betriebe, ein Elektrizitätswerk (das spätere Umspannwerk Christiania) und ein Knotenpunkt des Nahverkehrs. Anfang der 60er-Jahre endete der Straßenbahnverkehr der Linie 3. Die straßenbahnfreie Zeit dauerte bis 1995 - damals war die Osloer Straße die erste Strecke im Westteil, auf der wieder Trams fuhren. Genau wie in Oslo, wo die Straßenbahn bis heute überlebt hat.
Ein neuer Name in Norwegen – und später auch in Berlin
In Norwegen selbst war Christiania bereits im Wandel. Die Stadt wurde ursprünglich Oslo genannt – so hieß die mittelalterliche Siedlung am Oslofjord, bis sie 1624 nach einem Brand von König Christian IV. neu gegründet und nach ihm benannt wurde. Ab 1877 wurde der Name mit K geschrieben, also Kristiania. Vor 100 Jahren – 1925 – entschloss sich Norwegen, seine Hauptstadt wieder in Oslo umzubenennen. Ein Zeichen nationaler Selbstbestimmung und kultureller Eigenständigkeit nach der Unabhängigkeit von Schweden.
In Berlin allerdings änderte sich zunächst nichts. Die Christianiastraße blieb Christianiastraße – noch 13 Jahre lang. Erst am 4. November 1938 wurde sie offiziell in Osloer Straße umbenannt. Warum genau gerade zu diesem Zeitpunkt, ist nicht eindeutig dokumentiert. Es war keine politische Geste, sondern wohl eher eine sachliche Anpassung an die internationale Namenslage. Die norwegische Hauptstadt hieß nun Oslo – und Berlin zog nach.

Auch wenn der Name für viele heute nur ein Haltestellenname ist – die Geschichte lebt weiter. Der 1976 eröffnete U-Bahnhof Osloer Straße zeigt mit seiner rot-blau-weißen Farbgestaltung die Farben der norwegischen Flagge. Und das alte Umspannwerk Christiania, ein imposanter Backsteinbau an der Ecke Prinzenallee, erinnert noch immer an den ursprünglichen Straßennamen – heute als Teil eines Innovationszentrums.


Und Oslo heute?
Oslo – die echte, norwegische Hauptstadt – ist längst mehr als nur ein historischer Name. Mit rund 700.000 Einwohner*innen ist sie das politische und kulturelle Zentrum Norwegens und liegt eingebettet zwischen Fjord und bewaldeten Höhen. Besucher erwartet dort nicht der herbe Charme der Nordberliner Ringstraße, sondern ein Mix aus moderner Architektur, klarer Luft, viel Wasser, Natur und nordischer Gelassenheit. Ein Vergleich mit der teils lärmbelasteten und verkehrsreichen Osloer Straße in Berlin wird der norwegischen Schönheit kaum gerecht – aber die symbolische Verbindung zwischen beiden Orten bleibt bestehen.

So erzählt die Osloer Straße bis heute ein kleines Kapitel europäischer Geschichte – mitten im Wedding, zwischen Tram, Taxen und Supermärkten. Und vielleicht denkt der eine oder die andere bei der nächsten Fahrt durch die Osloer Straße an ein weit entferntes, kühleres Oslo – das mit dieser Straße einst mehr verband, als man heute ahnt.
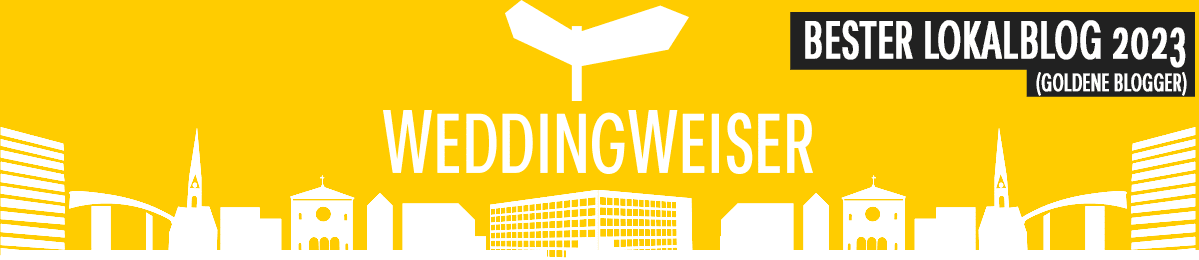

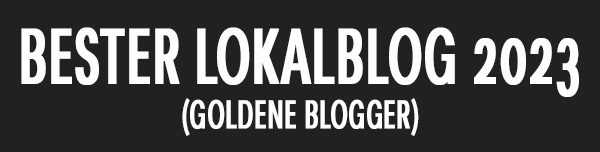


Bitte korrigieren: Norwegen war keine Kolonie Schwedens, sondern Dänemarks. Der König Christian IV. war der König von Dänemark, und einen berühmten Stadtteil namens Kristiania gibt es deshalb in Kopenhagen; heute ist er eine von seinen Bewohnern selbstverwaltete Freistadt.
Nicht nur in Verkehrsfragen gibt es einiges, was in Skandinavien viel besser läuft. Auch die Renten sind dort um einiges höher, bei vergleichbaren Einzahlungen (ähnlich wie in Österreich). Deutschland hat unter CDU und SPD den Rückwärtsgang eingelegt und fährt Vollgas, bis die Luft schwarz ist. Das kann leider in der Osloer Straße besichtigt werden.
Mit dem schönen, ruhigen und lebenswerten Oslo mit seiner modernen Verkehrspolitik und den ruhigen sicheren Staßen für Menschen statt für Autos hat die laute gefährliche und abweisende Osloer Straße mit ihrer Berliner 60er Jahre Verkehrspolitik nun wirklich nicht viel zu tun. Wenigstens wird man an die eigene Rückständigkeit so als Berliner regelmäßig erinnert wenn man Oslo schonmal erlebt hat.