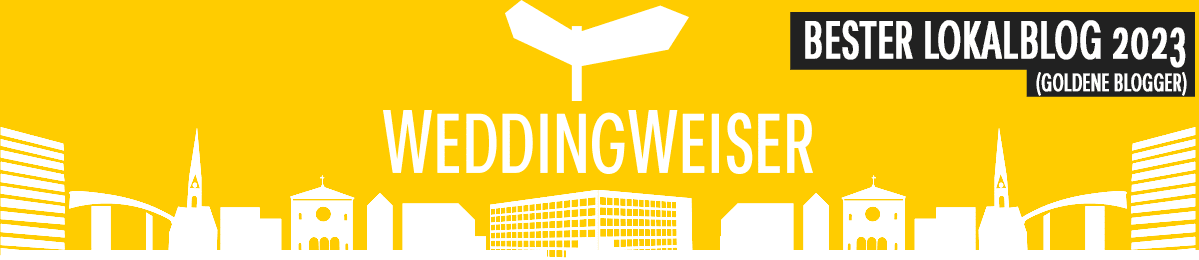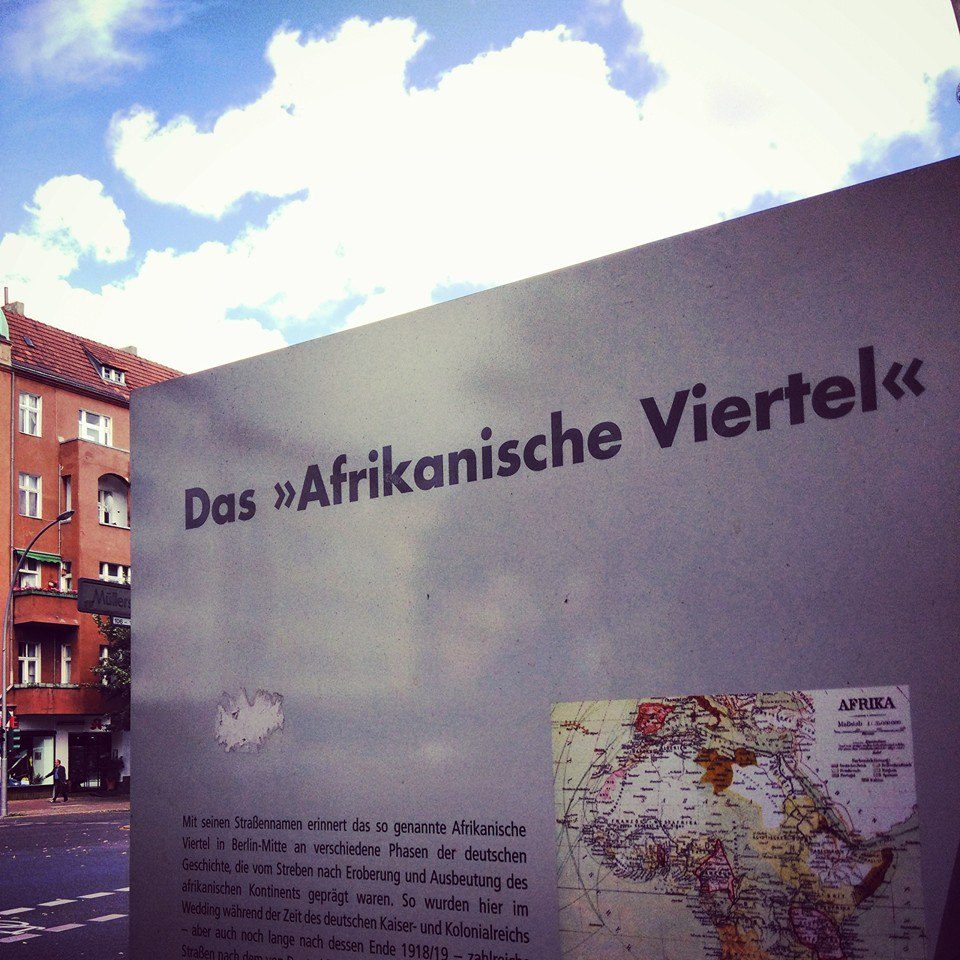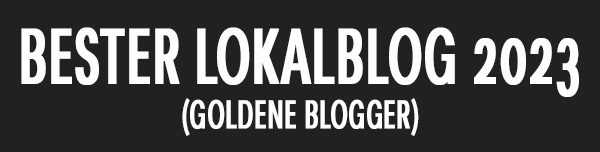Im grünen Norden des Wedding:
Afrikanisches Viertel – Ungewöhnliche Straßennamen
Wie in keinem anderen Teil von Berlin-Wedding spiegeln sich in diesem grünen Viertel Weltanschauungen und politische Einflüsse in den Straßennamen und in der Architektur der Gebäude. Togostraße, Kameruner Straße, Swakopmunder Straße - im ansonsten unscheinbar wirkenden Wohngebiet östlich…