
Wie wohnten die Menschen in „Meyers Hof“? Wer ging in die „Schrippenkirche“? Und an wen konnten sich obdachlose Frauen um 1900 wenden? Die „Berliner Spurensuche“ lud zu einer Führung zur Geschichte der Armut im Wedding an. Ein Dutzend Interessierte kamen, um sich bei schönstem Sonnenschein vom Historiker Stefan Zollhauser über das Leben armer Menschen, über solidarisches Miteinander und Erinnerungsorte der Armut informieren zu lassen. Unsere Autorin war dabei.
Elende Wohnquartiere in den Aufbruchjahren der Industrialisierung

Ausgangspunkt der zweistündigen Tour war die Ackerstraße, in unmittelbarer Nähe des „Dokumentationszentrums Berliner Mauer“. Der Name der Straße und auch angrenzende Straßennamen wie Feldstraße und Gartenstraße weisen darauf hin, dass Berlin vor 150 Jahren an dieser Stelle noch Stadtrand und von Landwirtschaft geprägt war. Der gewonnene Krieg gegen Frankreich 1870⁄1871 hatte Berlin zur Reichshauptstadt gemacht. Mehr und mehr Firmen der Schwerindustrie siedelten sich in der Randlage an. Bauland war hier noch erschwinglich und die Unternehmer trafen auf ein mit Kanälen und einer Ringbahn gut ausgestattetes Verkehrssystem. Die Industrie wiederum zog die arme Bevölkerung aus dem Umland an und die Zugezogenen benötigten dringend Wohnungen. Der Textilfabrikant Jaques Meyer errichtete in den 1870er Jahren in der Ackerstraße 132 einen aus mehreren Wohnblocks bestehenden Mietskasernenkomplex, in dem bis zu 2.000 Bewohner erbärmlich lebten. Eine Fotodokumentation der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) offenbarte 1918 die noch immer bestehenden, unhaltbaren Zustände der „Meyers Höfe“: winzige, dunkle, völlig überlegte Räume mit feuchten Wänden. Die Bewohner teilten sich nicht nur gemeinsame Korridore, sondern auch die wenigen Außentoiletten. Da die mangelhaften hygienischen Verhältnisse vermehrt zu Lungenkrankheiten führten, forderte die AOK den Staat, der selbst keinen Wohnungsbau betrieb, auf, Abhilfe zu schaffen.
Sozialer Wohnungsbau in der Weimarer Republik
Erstmals in der Weimarer Republik trat der Staat als Akteur des sozialen Wohnungsbaus auf: er erhob eine Sondersteuer für Immobilienbesitzer. Diese Steuermittel wurden in den 1920er Jahren unter anderem für die Errichtung der Schillerpark-Siedlung im Wedding verwendet, die heute zum UNESCO-Welterbe gehört. Wirtschaftliche Krisen im Deutschen Kaiserreich führten immer wieder zu Arbeitslosigkeit. Arbeitslose verloren schnell ihre armseligen Behausungen. Damit die Betroffenen wenigstens ihre Möbel vor der Pfändung durch den Vermieter retten konnten, boten Nachbarn ihre Wohnungen für das Abstellen der Habseligkeiten an. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1932⁄33, als besonders viele Menschen arbeitslos waren, traten die Bewohner der Meyers Höfe in den Streik. Sie forderten eine Sanierung der Wohnungen und eine Mietreduzierung. Im Zweiten Weltkrieg wurden mehrere Gebäude der Wohnanlage zerstört. Noch vorhandene Häuser wurden 1972 abgerissen und auf dem Gelände Neubauten errichtet. Eine Gedenktafel, die an die Geschichte der Bewohner erinnert, gibt es nicht.
Aktivitäten gegen Obdachlosigkeit – Christliche und bürgerliche Wohltätigkeit
 Nur wenige Meter weiter, an der Ackerstraße 52 und der Ackerstraße 136⁄137, gibt es hingegen gleich zwei Gedenktafeln und zwei Skulpturen, die an die barmherzigen Aktivitäten des protestantischen Journalisten Constantin Liebich (1847−1928) und des vom ihm 1882 gegründeten „Vereins Dienst an Arbeitslosen“ erinnern. Die Betroffenen erhielten Andacht und Frühstück, bestehend aus einer Tasse Kaffee und 2 Schrippen (Brötchen). 1900 zog der Verein, inzwischen stadtweit unter dem Namen „Schrippenkirche“ bekannt und von hunderten Menschen täglich besucht, in die Ackerstraße 52. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus zerstört. Das heutige mit der Bezeichnung „Schrippenkirche“ benannte Gebäude an der Ackerstraße 136⁄137 umfasst eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen und ein Integrationshotel.
Nur wenige Meter weiter, an der Ackerstraße 52 und der Ackerstraße 136⁄137, gibt es hingegen gleich zwei Gedenktafeln und zwei Skulpturen, die an die barmherzigen Aktivitäten des protestantischen Journalisten Constantin Liebich (1847−1928) und des vom ihm 1882 gegründeten „Vereins Dienst an Arbeitslosen“ erinnern. Die Betroffenen erhielten Andacht und Frühstück, bestehend aus einer Tasse Kaffee und 2 Schrippen (Brötchen). 1900 zog der Verein, inzwischen stadtweit unter dem Namen „Schrippenkirche“ bekannt und von hunderten Menschen täglich besucht, in die Ackerstraße 52. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus zerstört. Das heutige mit der Bezeichnung „Schrippenkirche“ benannte Gebäude an der Ackerstraße 136⁄137 umfasst eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen und ein Integrationshotel.
Von der Ackerstraße ging es über die Max-Urich-Straße und die Hussitenstraße vorbei am riesigen Areal, das einst der AEG gehörte, die in Berlin seit den späten 1880er Jahren vor allem Motoren, Turbinen und Lokomotiven produzierte. Auf dem Gelände arbeiteten damals mehr als 4.000 Männer und Frauen 12 Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche. Wer arbeitslos wurde, stand bald auch ohne Wohnung da. Liberale und sozialdemokratisch engagierte Persönlichkeiten aus der Berliner Bürgerschaft nahmen sich der obdachlosen Menschen an: 1868 gründeten der Industrielle August Borsig (1829−1878), der Arzt Rudolf Virchow (1821−1902) und der Mitbegründer der SPD, Paul Singer (1844−1911) gemeinsam mit weiteren Bürgern den „Berliner Asylverein für Obdachlose“, der 1897 die „Wiesenburg“ errichten ließ.
Die „Wiesenburg“ – Leuchtturm der Obdachlosenbetreuung um 1900
 Wir erreichten die baulichen Überreste des ehemaligen Asyl-Komplexes, der heute Standort für kreative und soziale Projekte ist, nach einem Spaziergang, der uns am S‑Bahnhof Humboldthain und über den Spielplatz an der Kolberger Straße an die Panke führte. Die architektonisch auffällige Anlage bot einstmals 700 Männern, ab 1907 auch 400 Frauen, Platz zum Waschen, Schlafen und Essen. Das Asyl wurde über die Landesgrenzen hinaus für seine moderne Ausstattung bekannt. Die Polizei hatte, anders als in städtischen Einrichtungen, keinen Zutritt. Heute steht die Ruine unter Denkmalschutz; eine hinter einem Rosenbusch verborgene Gedenktafel erinnert an die frühere Nutzung. Viele Straßen und Denkmäler in Berlin erinnern an Generäle und Schlachten. Warum, fragte Stefan Zollhauser zum Abschluss der Tour, gibt es eigentlich so wenige Erinnerungsorte, die an das leidvolle Leben armer Männer und Frauen und an ihre Solidarität erinnern? Eine Frage, die über einen Kiezspaziergang an einem schönen Sommertag hinauswirkt.
Wir erreichten die baulichen Überreste des ehemaligen Asyl-Komplexes, der heute Standort für kreative und soziale Projekte ist, nach einem Spaziergang, der uns am S‑Bahnhof Humboldthain und über den Spielplatz an der Kolberger Straße an die Panke führte. Die architektonisch auffällige Anlage bot einstmals 700 Männern, ab 1907 auch 400 Frauen, Platz zum Waschen, Schlafen und Essen. Das Asyl wurde über die Landesgrenzen hinaus für seine moderne Ausstattung bekannt. Die Polizei hatte, anders als in städtischen Einrichtungen, keinen Zutritt. Heute steht die Ruine unter Denkmalschutz; eine hinter einem Rosenbusch verborgene Gedenktafel erinnert an die frühere Nutzung. Viele Straßen und Denkmäler in Berlin erinnern an Generäle und Schlachten. Warum, fragte Stefan Zollhauser zum Abschluss der Tour, gibt es eigentlich so wenige Erinnerungsorte, die an das leidvolle Leben armer Männer und Frauen und an ihre Solidarität erinnern? Eine Frage, die über einen Kiezspaziergang an einem schönen Sommertag hinauswirkt.
Weitere Termine auf der Website
14.5.22 11 Uhr, Nettelbeckplatz
Quellen:
https://www.deutschlandfunk.de/geschichte-auf-dem-pruefstand-debatte-ueber-historische.724.de.html?dram:article_id=475892 [Straßennamen]
https://de.wikipedia.org/wiki/Meyers_Hof; https://www.berlinstreet.de/5563
http://www.trend.infopartisan.net/trd0513/t040513.html [Mieterstreik]
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrippenkirche
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09030287 [Schillerpark-Siedlung]
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/siedlungen-der-berliner-moderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Asylverein_f%C3%BCr_Obdachlose
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09030335
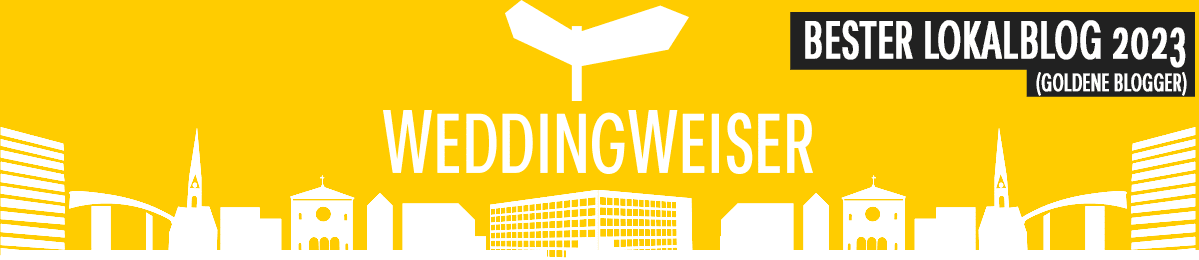

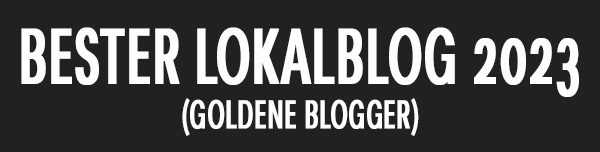


Schade eigentlich, daß immer wieder dieselben Ungenauigkeiten bei diesem spannenden Thema weiter erzählt werden.