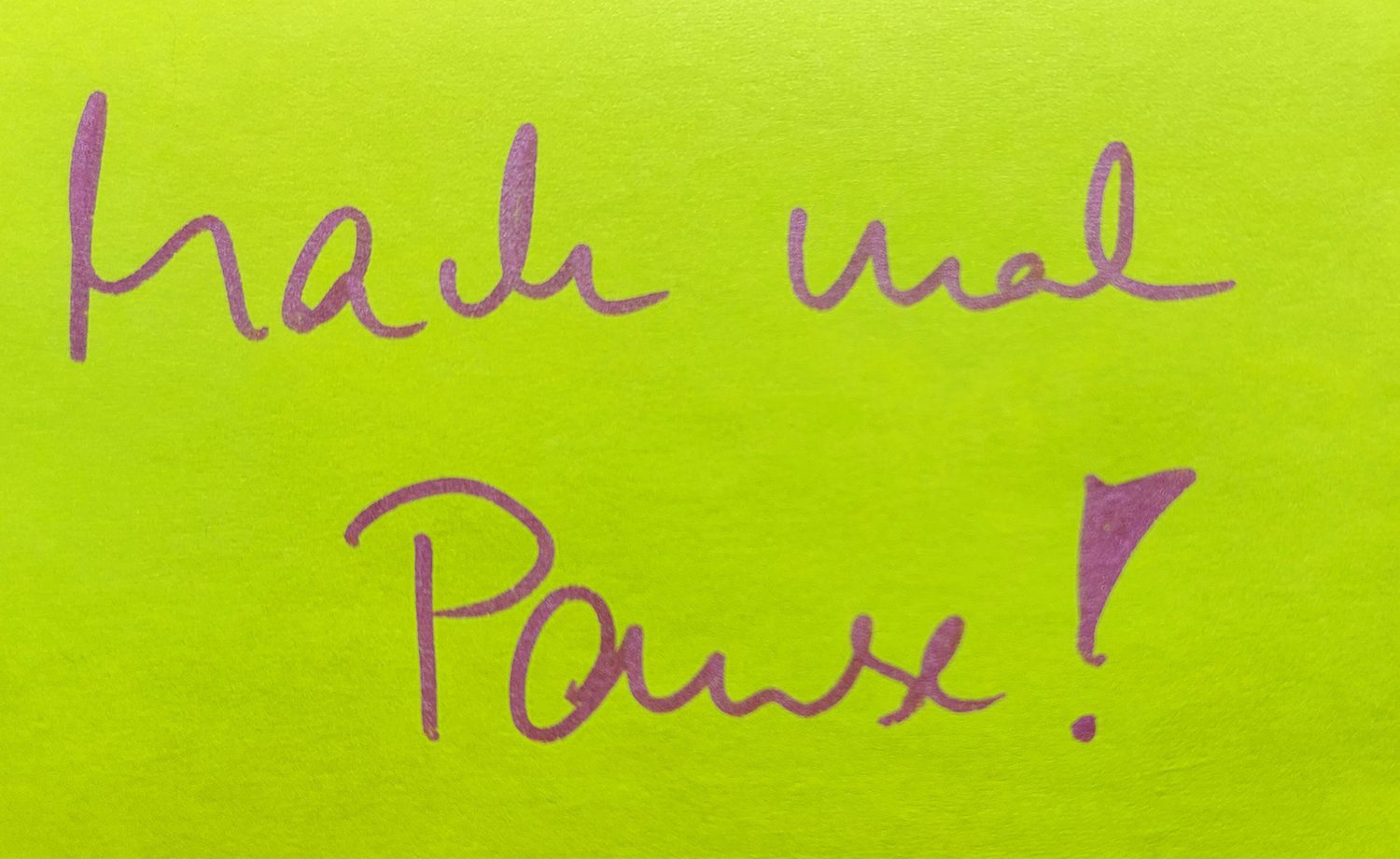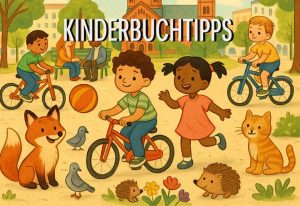Neulich traf ich mich mit einer Freundin in einem Café im Brunnenviertel, unweit der Mauergedenkstätte. Wir setzten uns ans Fenster mit Blick auf die breite Insel, die den Bürgersteig von der Brunnenstraße trennt. Hier bemalt eine Künstlerin nach und nach die Stämme der Bäume mit weißen, ornamenthaften Mustern. „Wie geht es dir?“, fragte ich meine Freundin, nachdem wir uns am Tisch eingerichtet und Kaffee bestellt hatten. Sie begann zu erzählen, dass sie beruflich mehrere Projekte am Laufen hat, die sich teilweise überlappen, und dass sie auch privat stark eingebunden. Wobei, wie sie anmerkte, das Berufliche und das Private manchmal gar nicht so richtig zu trennen sei.

Meine Freundin ist Freiberuflerin und selbst für die Struktur in ihrem Alltag zuständig. Als Selbstständige hat sie keine Vorgesetzten, die ihr sagen, was sie wann und wie lange zu tun hat. Sie seufzte, dass sie bis Ende des Herbstes kaum einen freien Tag im Kalender stehen habe. Wenn sie nicht aufpasse, sähen die Wintermonate bald ebenso aus.
„Selbst und ständig!“, sagte sie mit leicht gequältem Lachen, „du kennst ja den Spruch.“
Die Bedienung brachte unseren Kaffee, und während ich einen Schluck nahm, schaute ich aus dem Fenster auf die kunstvoll verzierten Baumstämme. Die Künstlerin, so dachte ich, muss eine Engelsgeduld haben. Mit feinen Pinseln arbeitet sie die Farbe so in die zerfurchten Stämme ein, dass am Ende trotz aller Unebenheiten ein glattes Bild entsteht. Es wird bis ins nächste Jahr hinein dauern, bis das Projekt vollendet ist, denn im Winter macht die Künstlerin bestimmt eine Pause.
„Winterpause!“, rief ich. Meine Freundin sah mich fragend an.
Ich schilderte ihr meine Gedanken: Dieses Kunstprojekt geht mit den Jahreszeiten, während denen die Bäume mehrmals ihr Erscheinungsbild ändern. Sie trugen frische hellgrüne Knospen im Frühling, haben jetzt, im Sommer, dichtes dunkelgrünes Laub, das sich im Herbst allmählich bunt verfärbt. Die Bäume ziehen in dieser Zeit alle Nährstoffe aus den Blättern, transportieren vorhandene Giftstoffe hinein und lassen dann das Laub fallen. Im Winter läuft der Organismus auf kleiner Flamme, der Baum ist kahl, macht Pause. Im Frühling beginnt der Zyklus dann wieder von vorn.
„Ich glaube nicht, dass ‚selbst und ständig‘ auf Dauer gesund ist“, sagte ich zu meiner Freundin. „Hast du dir mal überlegt, eine Winterpause einzulegen?“ „Nicht so wirklich …“, gab sie zu.

Mit Blick auf die wunderschönen weißen Muster sinnierten wir über die Kreisläufe des Lebens. So wie die Natur sich immer wieder in Zyklen neu erfindet, so sind auch wir Menschen Zyklen unterworfen. Auch für uns gibt es bestimmte Zeiten, etwas zu initiieren, es heranwachsen zu lassen und zu pflegen, dann die Früchte zu ernten und uns schließlich auszuruhen. Leider haben wir Menschen verlernt, unsere Zyklen zu respektieren. Stattdessen glauben wir, immer gleich leistungsfähig sein zu müssen. Was wir dabei oft vergessen, ist die Winterzeit. Eine Zeit, in der scheinbar nichts produziert, nichts geleistet wird. Doch wir Menschen als Teil der Natur brauchen genau diese Ruhephase. Um uns zu sammeln. Die Kräfte nach innen zu ziehen. Alles loszulassen, was nicht mehr dienlich ist. Und das, was bleiben soll, neu anzuordnen.
Ohne den Winter gäbe es in unseren Breiten keine Veränderung und keinen Neuanfang. Ohne Winter würde das System früher oder später zusammenbrechen.
Irgendwann wurde es Zeit zu gehen. Wir tranken unseren Kaffee aus, schlenderten durch die Allee mit den verzierten Bäumen und bewunderten die vielfältigen Muster und Ornamente. Als wir zu den Stämmen kamen, die erst im kommenden Jahr bemalt werden, fassten wir einen Entschluss: „Sobald wir zu Hause sind, tragen wir ausreichend freie Tage in unsere Kalender ein. Von wegen ‚selbst und ständig‘. Es lebe die Winterpause!“