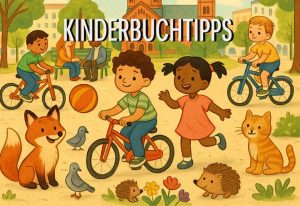Das jahrelange Drama um die neuen Straßennamen im Afrikanischen Viertel hat es jetzt sogar auf die internationale Bühne geschafft. Die Schweizer Inszenierung des Stückes „Vielleicht“ des Afro-Europäers Céderic Djedje hatte im April auch ein kurzes Gastspiel beim Festival FIND 2023 in der Schaubühne am Lehniner Platz. Es ist ein Stück, das unbedingt weitere Aufführungen in den Schulen und auf den Bühnen Berlins erleben sollte.

„Peut-être (Vielleicht)“ ist ein Stück voller Fröhlichkeit und Zuversicht – was zuerst einmal überrascht, wenn man weiß, mit welcher Verbissenheit um die neuen Straßennamen in Berlin jahrzehntelang gekämpft werden musste. Ein Stück voller Spielfreude und voller Freude über das gegen alle Widerstände Erreichte.
„Wie werden wir feiern, wenn wir unser Ziel erreicht haben?“ Das war die erste Frage des Autors, der auch selbst auf der Bühne stand. In den buntesten Farben malte er mit seiner Schauspielkollegin Safi Martin Ye das Straßenfest aus, sie im Afrikanischen Viertel feiern werden, wenn die Straßen endlich nach Afrikanerinnen und Afrikanern benannt sein werden. Das passte zu dem Bühnenbild, das sich aus schwebenden Papierdrachen zusammensetzte, dem Spielzeug, das für hochfliegende Träume steht.
„Wie beschreibst du das Afrikanische Viertel im Wedding einer Person, die noch nicht da war?“ Diese Aufgabe stellte sich der französischsprachige Autor Céderic Djedje, als er 2018 als Stipendiat für ein halbes Jahr von Genf in den Wedding zog und in der Wiesenstraße 29 wohnte. Seine Eindrücke hat er in das Theaterstück einfließen lassen, das im November 2022 in Genf seine Uraufführung hatte. Der graue, raue Wedding vorgestellt im schönen reichen Genf. Dieser Kontrast hätte Stoff genug geboten. Und doch widersteht er der Versuchung, in die üblichen Migrantenghetto-Klischees von Müll, Armut und Gewalt zu verfallen, von denen die Wedding-Berichte deutscher Medien voll sind. Er schaut genau hin und das tut dem Stück gut. „Das Afrikanische Viertel war kein afrikanisches Ghetto, wie ich es aus Paris oder Brüssel kannte. Kein Viertel, in dem vor allem afrikanische Migranten wohnten“, lässt er das erstaunt das Publikum wissen. Und er freut sich. Er erzählt, wie es damals war, als er als junger Mann mit einer Dating-App unterwegs war im Wedding. Er fühlt sich als „Goldnugget“, weil er als einer der wenigen Afrikaner im Wedding ein attraktiver Dating-Partner ist. Bis dahin ist das Stück ein Tagebuch eines lebensfrohen Gast-Stipendiaten, der sich gerne zu Dates im Bantou-Village in der Kameruner Straße trifft. Djedje erfährt, dass der Wedding „im Kommen“ ist, was er auf Französisch in „Un quartier en devenir“ und politisch in „Es wird ein Viertel für die weiße Mittelschicht“ übersetzt. Und spätestens da wird das Private politisch.


Als Sohn afrikanischer Eltern von der Elfenbeinküste geht er mit anderen Augen durch die Straßen. Und es bedrückt ihn mehr und mehr, dass man hier unter Afrika vor allem Safari und exotische Tiere versteht. Die Bilder im U‑Bahnhof Afrikanische Straße zeigen Löwen und Nashörner, aber keine Menschen aus Afrika. Die Straßen sind nicht nach Afrikanern benannt, sondern nach Tätern des deutschen Kolonialismus wie Lüderitz und Peters. Er sucht nach dem tieferen Grund für sein Unbehagen und trifft sich im „Fredericks, dem ehemaligen „Lüderitz-Eck“, das für ihn ein Beispiel für eine gentrifizierte Kneipe ist, mit Mitgliedern von Berlin-Postkolonial, der Initiative, die sich seit Jahren für die Umbenennung der Straßen im Afrikanischen Viertel kämpft. „Das Afrikanische Viertel ist kein Viertel der Afrikaner, es ist ein koloniales Viertel, in denen die Deutschen die Namen der Länder verewigen wollten, die sie besaßen – oder gerne besessen hätten.“, wie er grinsend hinzufügt.


Was dann folgte war eine Aufklärung über die deutschen Kolonialkriege in Afrika – halb Expedition, halb Geisterbahnfahrt. Eine Lehrstunde über das Leben und den Tod der Täter und der Opfer, die nichts aussparte aber auch hier seine Leichtigkeit behielt. Slapstick-Einlagen mit Operettenuniformen, die das Treffen von Carl Peters und Kaiser Wilhelm II zeigen sollten, erinnerten an die Aufklärungsstücke des Grips-Theaters, die auch schwierige Themen mit einem Augenzwinkern zeigen können. Und mit Ironie präsentiert er auch die Positionen der Weddinger Initiative „Pro Afrikanisches Viertel“, die die Umbenennung jahrelang verzögerte. So als seien sie ein Witz. „Geister gegen Geister“ nannte er den Kampf. Namen toter Männer gegen Namen anderer toter Männer.
Zum Schluss wird das Politische wieder persönlich, als der Autor, nun seiner kolonialen Geschichte bewusst, in einen Dialog mit seiner per Video eingespielten Mutter geht, und sie fragt, warum sie ihm nicht ihre Muttersprache beigebracht habe. Warum er nur die Kolonialsprache Französisch spreche. Symbolisiert werden die wiedergefundenen Wurzeln durch einen Haufen Erde, aus dem die Schauspieler zärtlich Bilder von afrikanischen Widerstandskämpfern ausgraben.
Das in dem Stück von 2022 nur erträumte Fest zur Umbenennung hat es inzwischen gegeben. Der König der Duala war da und unterstrich mit seiner Anwesenheit die Wichtigkeit und die Würde dieses Augenblicks, die sich Céderic Djedje und seine Co-Autorin Noémi Michel gewünscht haben. Und obwohl das Stück hier stehen bleibt (und höchstens von weiteren Umbennenungen von Straßen träumt), wäre es wichtig, dass mehr Menschen in Berlin es sehen können. Weil es ein französischsprachiges Stück ist, könnte ich mir eine Aufführung im Centre Français vorstellen. Aber auch das Prime-Time-Theater würde sich als Bühne anbieten. Es gibt einem als Bewohner des Afrikanischen Viertels genug Gelegenheit, über sich selbst zu lachen.
Fotos Theaterstück: Dorothée Thébert Filliger, Foto Schaubühne außen: Rolf Fischer