
Waschmaschinen kamen in Deutschland erst in den 1950er Jahren auf den Markt. Bis sie bezahlbar waren und in fast allen Haushalten standen, dauerte es ebenfalls noch ein paar Jahre. Wie haben die Menschen in Altbauvierteln wie dem Wedding früher ihre Wäsche gewaschen? Die Mietshäuser waren durchaus darauf ausgelegt – aber lest selbst.

Eine Zeitzeugin berichtet aus ihrer Kindheit im Berlin der 1950er Jahre, typisch für viele im Wedding, die sich keine Waschfrau oder eine Wäscherei leisten konnten:
“Wir lebten in einem alten Mietshaus. Jedes Treppenhaus führte zu acht Wohnungen, die alle mit Kachelöfen beheizt wurden. Auch die Bäder hatten zylinderförmige Badeöfen, die mit Holz und Kohle betrieben wurden. Im Dachgeschoss gab es für jeweils fünf Hauseingänge zwei Waschküchen und zwei Trockenböden. Um die Waschküche zu nutzen, musste man sich beim Hausmeister anmelden und erhielt dann den Schlüssel für die Waschküche und den Trockenboden. Einmal im Monat stand die Große Wäsche an, eine mühsame Angelegenheit, da die Waschküche von vielen Familien gemeinsam genutzt wurde. Kleinere Wäschen wurden zwischendurch auf dem Herd in der Küche gekocht, in einer Schüssel gewaschen und in der Badewanne gespült.
Die Waschküche selbst war mit einem beheizbaren Kupferkessel, einem emaillierten Ausguss, mehreren Zinkwannen auf Holzböcken und einer Toilette ausgestattet. Die Zinkwannen gehörten den Bewohnern, wurden aber gemeinschaftlich verwendet. Schon am Abend vor dem Waschtag wurde die Wäsche eingeweicht. Die Weißwäsche kam als erstes in den großen Waschkessel, den mein Vater am Waschtag oft schon früh morgens befeuerte. Das Holz und die Kohle mussten dabei mühsam aus dem Keller bis in die Waschküche hochgetragen werden – eine echte Herausforderung, vor allem für die Bewohner des Erdgeschosses, die vier Stockwerke nach oben mussten. Wir wohnten im dritten Stock, was meiner Mutter das Hochbringen der nassen Wäsche zumindest etwas erleichterte. Wenn ich zur Schule ging, war meine Mutter bereits in der Waschküche. Sie hatte schon am Vortag einen Eintopf vorbereitet, damit das Mittagessen gesichert war.

Foto: Samuel Orsenne
Nach der Schule lief ich direkt zur Waschküche, und oft konnte ich meine Mutter im dichten Dampf kaum sehen. Sie stand am Waschbrett und schrubbte mit der Wurzelbürste, fischte die heiße Wäsche mit einer großen Holzkelle aus dem Kessel und schmiss sie in die Zinkwanne. Nachdem die Weißwäsche im ersten Gang gewaschen war, kam sie nochmal in den Kessel, um sie mit Bleichmittel klar zu waschen. Die erste Waschlauge wurde anschließend für die Buntwäsche verwendet. Der Waschkessel hatte keinen Auslauf, weshalb das Wasser mit Eimern ausgeschöpft werden musste. Alles war klitschnass. Für mich als Kind waren diese Arbeiten spannend, obwohl ich wusste, wie anstrengend sie waren. Ab und zu durfte ich auch mal helfen, rubbeln oder das Wasser aus der Zinkwanne ablassen. Das Spülwasser ließen wir einfach auf den Boden abfließen, wo es in einem Abfluss verschwand. Am Ende musste der Kupferkessel gründlich gereinigt werden.

KI-generiertes Foto
Das Aufhängen der Wäsche auf dem Trockenboden war ebenfalls immer ein Erlebnis. Zwischen den aufgehängten Laken und Bettbezügen konnte man wunderbar hin- und herlaufen, doch meine Mutter hatte immer Angst, dass die frische Wäsche dabei wieder dreckig wurde. Jede Familie hatte ihre eigene Wäscheleine, die man jedes Mal neu spannen und am Ende wieder sorgfältig aufrollen musste. Die Wäsche wurde mit einfachen Holzklammern aufgehängt.

KI-generiertes Foto
Am Abend war meine Mutter dann völlig erschöpft und dachte bestimmt schon an die nächste Aufgabe: die großen Wäschestücke mussten noch zur Mangel gebracht werden und die kleineren Teile bald auf das Bügelbrett. Die Mangel, die ‚Rolle´, war eine große elektrische Presse, die in der Hinterstube des Seifenhändlers stand und gegen eine Gebühr genutzt werden konnte. Dabei rollte ein schwerer Holzkasten über runde Holzstangen, auf die die Wäsche aufgerollt wurde, am Ende kam das sogenannte Rolltuch. Wenn der Kasten am Tischende angekommen war, kippte er leicht, sodass meine Mutter die Wäsche entnehmen konnte. Als Kind hatte ich immer Angst, dass der schwere Kasten herunterfallen könnte.
Obwohl es damals schon Wäschereien in der Stadt gab, zogen es die meisten Hausfrauen vor, ihre Wäsche selbst zu waschen, um sicherzugehen, dass sie sorgfältig behandelt wurde und länger hielt. Das war nicht nur gründlicher, sondern half auch, das Haushaltsbudget zu schonen.”
Erinnert ihr euch an die Große Wäsche? Gibt es in euerm Haus auch noch solche Räume im Dachboden? Teilt gerne eure Erinnerungen in den Kommentaren.
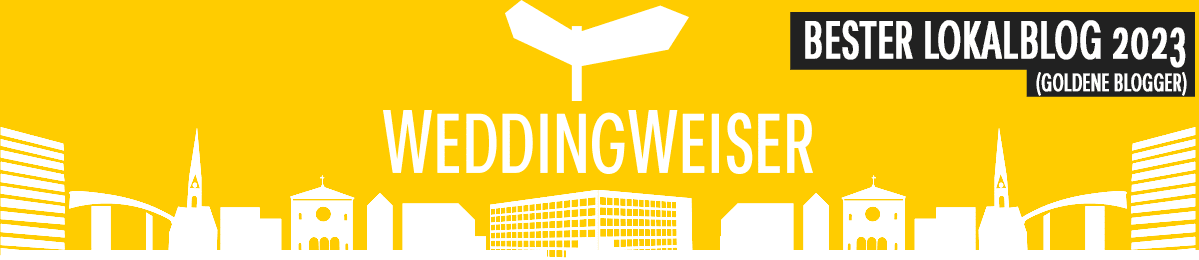

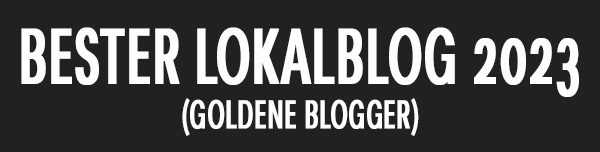


Kann die Autorin/der Autor bitte die Quelle der Schwarz-Weiß-Bilder kennzeichnen? Bei dem Farbbild ist ja auch eine Quelle angegeben. Auf mich wirken die Schwarz-Weiß-Bilder KI-generiert, was natürlich eine skandalöse und höchst fragwürdige Geschichtsverfälschung wäre (zumal auch noch ohne Kennzeichnung).
Die Bilder sind tatsächlich KI-generiert. Die Kennzeichnung wird nachgeholt. Für ein ehrenamtliches Portal ist es im Übrigen völlig okay, zu Themen, für die es keine kostenfreien Fotos gibt, mit KI zu arbeiten. Der Begriff Geschichtsverfälschung ist definitiv übers Ziel hinausgeschossen.
Einerseits schöne, aber auch verfälschende und idealisierende Fotos, die mir Unbehagen bereiten – Heim, Herd, glückliches Hausfrauendasein usw.
Wie bereits angemerkt wurde, war das eine ganz üble Schinderei, die sich heute keiner mehr vorstellen kann.
Die Wäschemangel im Nebenraum unserer Drogerie machte so schauerliche Geräusche das ich mich als kleiner Junge dort nicht hineintraute ‚ich empfand dieses für mich riesige Teil als bedrohlich. Dieser Laden war in der Müllerstr.in der Einkaufszeile gegenüber der Straßenbahnhalle .Da es noch selten Kühlschränke gab wurde hier fast täglich eingekauft ‚so mein Erinnerung aus den späten 50 er Jahren
Hallo
Mutter hatte immer Angst um ihre Finger …. ja und echt laut gerumpelt hat so ein Teil
Bei uns stand so ein Teil Wiclef/Ecke Emdener
https://www.suchebiete.com/foto_Waeschemangel_Waesche_Rolle_antik_Ostalgie,7024346.html
Gruß
Meine Oma hatte das Waschbrett und die Riesentöpfe ihrer alten Waschküche noch und zeigte mir, wie sie sich damals einen Bruch durch das Anheben der schweren Last gehoben hat. Für den Rest ihres Lebens musste sie mit einem Bruchband herumlaufen.
Die Waschküche im Mietshaus habe ich als kleiner Junge noch erlebt, aber es standen bereits elektrische Waschmaschinen darin. Da habe ich meiner Mutter ein bisschen helfen können. Als ich, im Alter ab ungefähr 10 Jahren, die Wäsche selbstständig machte (gegen Taschegeld-Aufschlag), stand die Waschmaschine bereits in der Wohnung.
Bis heute breche ich mir keinen ab, wenn ich die Wäsche auf einen Wäscheständer hänge. Sowas irre Geld und Energie-Verschwendes wie einen Elektro-Trockner, nur damit heute die ganz Faulen das Wäsche-Aufhängen einsparen können, gab es damals noch nicht.