Es geht um ein ernstes Thema, besonders in unserer veränderten Stadtwelt und Lebensumwelt: den einsamen Tod. Und hier geht es um Menschen, die vermutlich nicht nur unbegleitet verstarben, sondern deren Leichen tagelang, für Wochen oder sogar Monate unentdeckt in Wohnungen liegengeblieben sind. Muss das in der Großstadt passieren? Unsere Autorin hat eine einfache Idee, wie man besser füreinander sorgt.



In der Tagespresse werden solche Todesfälle als Einzelfall dargestellt, jedoch gehören diese strukturell zu den moderneren Phänomenen des städtischen Soziallebens. Der Tod gerät, auch im Wedding, immer mehr ins Abseits.
Als der Charité-Rechtsmediziner Prof. Tsokos bekanntgab, dass er etwa 2.400 Obduktionen in Berlin-Mitte jedes Jahr durchführen müsse (Berliner Zeitung vom 13. Feb. 2022), worunter auch spät entdeckte Wohnungsleichen seien, war ich zutiefst erschüttert. Manchmal seien es als erste die Gastwirte, die ihre Kneipenbesucher an der Theke vermissen, nicht etwa Angehörige, Hausnachbarn oder der Vermieter, der keine Mietzahlung mehr erhält. Diese Ignoranz gegenüber Vereinsamten, Alten und Versterbenden ist in einer toleranten Stadt wie Berlin nicht hinnehmbar.
Soeben erschien eine Studie von Susanne Loke, die sich dem Thema dem Phänomen der sogenannten Wohnungsleichen widmet. Susanne Loke hat für Ihre Studie aus etwas über 71.000 Sterbefällen in den Jahren von 2006 bis 2016 in zwei deutschen Städten diejenigen mehr als 3400 Fälle untersucht, die zu den sog. unentdeckten Toten gehören. Nach ihrer Definition sind dies diejenigen Verstorbenen, die länger als 12 Stunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht vermisst oder angefunden wurden. Frau Loke schätzt, dass etwa 20 Prozent der privaten Sterbefälle verzögert entdeckte Tote sind. Probleme der Vereinsamung und unbegleitetes Sterben spielen stark in dieses Geschehen hinein, ebenso wie die Nachbarschaften und deren Netzwerke.
Historisch besehen hat sich seit dem 19. Jh. ein großer Wandel in der Sterbekultur gezeigt. War in dieser Zeit noch der Lebensort auch der Sterbeort, so hat sich dieser räumliche Zusammenhang immer mehr aufgelöst mit den modernen Kleinfamilien, den Patchwork-Familien, dem Singledasein und zudem den entfremdeten oder einseitig strukturierten Nachbarschaften vor allem in den Städten. Hinzu kommt: Lag die Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland um das Jahr 1881 noch bei sage und schreibe nur 35 (Männer) und 38 (Frauen) Jahren, so liegt diese in den Jahren 2019⁄2021 bei 78 (Männer) bis 83 (Frauen) Jahren. Durch das ansteigende Lebensalter mit mehr gesunden Jahren rückt auch die Erfahrung des Sterbens aus dem Horizont der jüngeren und mittleren Altersgruppen.
Diese Hochaltrigkeit kann aufgrund mangelnder Erfahrung Abwehrhaltungen verstärken. Gleichzeitig entrückt das Sterben in den Medien und im Internet immer mehr dem Privaten und Persönlichen. Zudem werden die Rituale, die mit dem Sterben verbunden sind, außer Kraft gesetzt, in den Hintergrund gerückt, während dabei individuellere Bedürfnisse für das Lebensende und das Bestatten in den Vordergrund treten. Die Bestattung selbst wird häufig in engen, teils geschlossenen Personenkreisen durchgeführt.
Hinzu kommt der Trend, wonach die Sterbenden in medizinische und pflegende Einrichtungen ausgesondert wurden. Und dort, wo Fachkräfte damit befasst sind, entsteht die Illusion vom hygienischen Tod.
Damit einher geht, dass alle Beteiligten, dem Sterbenden wie den Angehörigen, der Tod entfremdet und das Erleben des Sterbens und des Todes entpersönlicht wird. Wo Sterbende wie in Pflegeheimen oder Hospizen zu den Routineaufgaben gehören, herrscht eine soziale Isolation der alten Menschen.
Das erste Hospiz wurde 1967 Jahren durch Cicely Saunders in England gegründet, in den 1980er fanden diese auch in Deutschland Verbreitung. Weiterhin wurden die Sterbeorte mit den Palliativstationen aus den privaten, familialen und persönlicheren Zusammenhängen verstärkt ausgegliedert.
Einsamkeit und Armut gehen Hand in Hand
Was Frau Loke betont, ist die Verbindung von Einsamkeit und Altersarmut. Einsamkeit kann Menschen in prekären Lebenswelten nicht additiv, sondern sich verstärkend in noch mehr Vereinsamung bringen und von Kontakten und Hilfen abschneiden. Und das betrifft nicht nur alte und alternde Menschen. Schließlich können manche Stadtviertel aufgrund hoher Armutsrisiken und Armutslagen schon so brüchig in ihren sozialen Strukturen sein, dass Abhilfe untereinander kaum noch möglich ist, weil zu viele Ressourcen fehlen. Die Sterbedaten lassen den Schluss zu, dass Armut ein entscheidender Faktor für diese verzögert entdeckten Toten ist.
Idee: Postkarten in den Briefkasten stecken
Ich frage mich: Sollten wir nicht mehr Rücksicht und Vorsicht bei unseren Nachbarn walten lassen? Wie kann man in Stadtvierteln sicherstellen, dass man, ohne übergriffig zu werden, erfährt, ob ein alter Mitbewohner schon aus den Ferien zurück ist? Eine eher private und sichere Lösung unter älteren Hausnachbarn ist zum Beispiel das regelmäßige Austauschen von Postkarten mit aktuellen Grüßen und Infos zum Wohlergehen, und damit ist man davor sicher, nicht jeden Tag miteinander plaudern zu müssen und sich trotzdem im Blick zu haben. Ich denke, das sollte man vor Ort sehen, absprechen und regeln. Ich bin mir sicher: Auch in Stadtvierteln wie den Wedding sollte das leicht möglich sein.
Text: Renate Straetling
_______________________________
Loke, Susanne, Einsames Sterben und unentdeckte Tode in der Stadt, Über ein verborgenes gesellschaftliches Problem, transcript Verlag, Bielefeld 2023, ISBN 978–3–8376–6648–9
Über Susanne Loke: Sie ist Lehrbeauftragte an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Sie promovierte zum Thema einsames Sterben und unentdeckte Tode in der Stadt. Schwerpunktmäßig widmet sie sich den Themen Einsamkeit, Thanatologie, soziale Gerontologie und Sozialraumforschung.
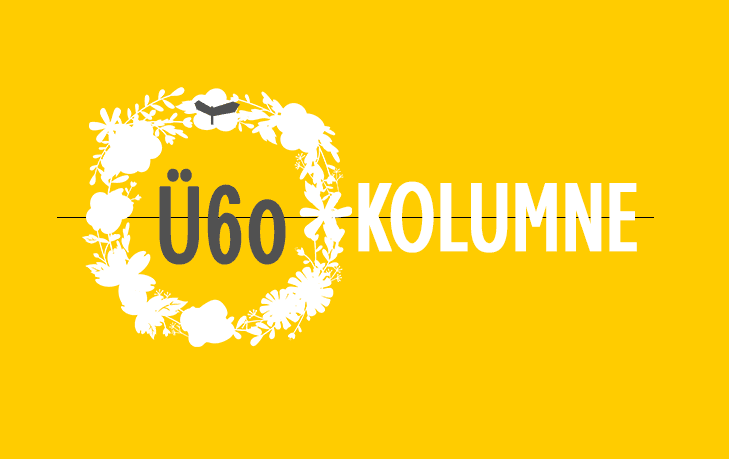





Mir fällt auch noch eine weitere gute Konvention ein, die vor allem für lockere Nachbarschaften geeignet ist und dann, wenn man sich gegenseitig in die Fenster schauen kann.
Eine gute und einfache Absprache kann darin bestehen, bestimmte Deko-Teile nach Verabredung ins Fenster zu hängen und damit zu signalisieren, ob man daheim, alles ok oder ob man verreist ist. Solche einfachen Deko-Schmuckteile bekommt man hier und da für einen Euro und man kann diese an jedem der sieben Wochentagen austauschen.
Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn ältere Menschen sogenannte Telefonketten bilden, jeden Morgen ein Anruf könnte ein gewisses Geborgenheitsgefühl vermitteln.